Teure-Zwei-Klassen-Medizin

Unter dieser Schlagzeile berichtete die Berliner Zeitung am 18.2.20 als Aufmacher auf der Titelseite über die Bertelsmann-Studie “Geteilter Versicherungsmarkt”. Fazit der Studie ist “… ein eindeutiges Plädoyer für eine gemeinsame Krankenversicherung für alle Bürger”.
Hier die Widerlegung, mein nicht veröffentlichter Leserbrief als Insider: Die Debatte um die Abschaffung der Privatversicherung ist blauäugig und bekommt den Charakter eines Meinungskrieges. Die behauptete Einsparung von 148 Milliarden Euro setzt die ersatzlose Senkung der Privathonorare auf Kassenniveau voraus. Diese Summe den Krankenhäusern und Arztpraxen wegzunehmen würde unser Gesundheitswesen zum Kollabieren bringen. Bliebe aber das Geld der Privatversicherten im System, schrumpft der vermutete Vorteil auf 4 Euro im Monat pro Versicherten, sofern die angenommenen Rechenparameter der Studie stimmen. Und Vorteile für gesetzlich Versicherte? Bei Service und den Wartezeiten kaum. Aber Nachteile jede Menge: Dass jeder in Deutschland, gleich ob gesetzlich oder privat versichert, Spitzenmedizin bekommt, liegt an der Investitionskraft, die die Honorare der Privatpatienten bewirken. Ich habe fast vierzig Jahre lang eine internistisch-hausärztliche Praxis geführt. Das Ultraschallgerät für hunderttausend Euro konnte ich wegen meiner Privatpatienten kaufen; untersucht habe ich damit fast ausschließlich Kassenpatienten. Otto Normalverbraucher weiß nicht, wie vielfältig derzeit in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) verdeckt rationiert wird und dass die Vergütung gedeckelt ist, um Beitragsstabilität trotz Teuerung und medizinischem Fortschritt zu sichern. Krankenhäuser und Praxen haben ein Budget. Das Medikamentenbudget führte seinerzeit dazu, dass die BKK Stadt Berlin (später City-BKK) Hunderte von Ärzten wegen unwirtschaftlicher Verodnungsweise zur Kasse bat, weil sie das Medikament Norvasc (Amlodipin) verordnet hatten, gleichwohl es später Standard in der Therapie wurde. Neue Methoden, ob diagnostisch oder therapeutisch, werden von Privatversicherern getragen und gelangen, weil von Vorteil, verzögert dann auch zum Einsatz in der GKV. Der Hinweis, dass könne wie im Fall von Lipobay von Nachteil sein, sticht nicht, weil auch etliche Medikamente im Kassenbereich wegen unerwünschter Nebenwirkungen wieder zurückgezogen werden mussten. Konnte man in den 80er Jahren mit dem normalen Kassenhonorar allein gut eine Praxis führen, braucht man jetzt Einnahmen aus Sonderverträgen oder private Zusatzeinnahmen, um über die Runden zu kommen. Für ein Quartal lang Behandlung eines Kassenpatienten bekommen der Augenarzt 21,08 €, der Urologe 23,76 €, der Hautarzt 15,51 € zugeteilt. Der Hausarzt bekommt 40,33 € pro Fall; aber wenn eine Kranke 10x im Quartal kommt, wird es auch nicht mehr. Die Beispiele zeigen die Schieflage der GKV. Krankenhäuser können nicht angemessene Arbeitsbedingungen, ausreichende Pflege und Reinigung/Hygiene finanzieren.
Mit Einbeziehung der Privatversicherten in einer Bürgerversicherung würde keines der Problem gelöst werden, aber neue Verfahren könnten leichter den Kranken vorenthalten werden. Überall auf der Welt, nicht nur in England, leiden die staatlichen Gesundheitssysteme an Unterfinanzierung. Und wer Geld hat, kauft sich Sonderbehandlung, ob in Spanien, Polen oder sonst wo. Das lässt sich nicht abstellen, auch wenn der Traum einer sozialistischen Gleichmacherei Motiv sein sollte. Stört eine 1. Klasse bei Eisenbahn oder Flugzeug? Den Unterschied macht nur der Service, alle kommen zugleich an. So hat das Eintreten für eine Bürgerversicherung Ideologiecharakter. Parteien nehmen sie in ihr Programm auf, weil es ein Neidgefühl anspricht, dass Stimmen bringen soll, und weil davon ausgegangen werden kann, dass kaum einer der Wähler/innen um die damit verbundenen Nachteile weiß.
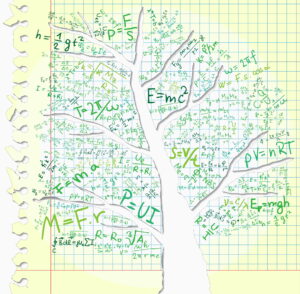
Ich kenne den Artikel der Berliner Zeitung nicht, insofern kann ich zu dessen Aussagen nichts sagen. Da ich aber auch ein Befürworter einer einheitlichen Versicherung für alle bin, ob man diese nun Bürgerversicherung oder auch anders nennt, ist nicht so wichtig, möchte ich auf einen Denkfehler der Argumentation hinweisen. Die Zustandsbeschreibung im Blog ist richtig (ohne Privatpatienten wären viele Praxen nicht überlebensfähig) und auch der Schlussfolgerung, die privaten Versicherungen einfach in die GKV einzugliedern, würde keine Verbesserung bringen, eher das Gegenteil, könnte ich zustimmen. Aber wer will das schon? Ich jedenfalls nicht.
Das ganze bestehende GKV-System ist krank inklusive der Vergütung der Krankenhäuser mit den Fallpauschalen. Insofern wäre es natürlich Blödsinn, die funktionierenden privaten Versicherungen in das kranke System hineinzuzwingen, und dann zwar mit einem gemeinschaftlichen, aber eben mit einem kranken System weiterzuleben.
Ich bin kein Fachmann und insofern macht es keinen Sinn, hier ein besseres Konzept darzulegen. Aber mir erscheint es logisch, dass man für eine neue einheitliche Versicherung ganz neue Strukturen schaffen muss und man nicht einfach ein nicht funktionierendes System weiter führt. Nur als Gedankenspiel: Nicht die Privaten in die GKV überführen, sondern die GKV in die Privaten Versicherungen integrieren oder wie die Privaten organisieren. Dann funktioniert wahrscheinlich alles besser und es braucht meiner Meinung nach nicht für die Versicherten teurer werden. Nimm ich mein eigenes Beispiel: Ich bin seit Anfang meines Beruflebens, seit über 45 Jahren, Privatpatient und meine Frau und unsere drei Kinder überwiegend auch, und ich behaupte, da ich die ganzen Jahrzehnte regelmäßig die Beiträge der GKV und meiner privaten Versicherung miteinander verglichen habe, dass ich in der Lebenssumme insgesamt weniger Beitrag gezahlt habe, als wenn ich die ganze Zeit in der GKV gewesen wäre. Das Problem, das keine Private Versicherung die schwerkranken, also teuren, Kunden haben will oder die Beiträge dann unbezahlbar wären, kann man lösen, indem alle Beitragszahler in einen Fond einzahlen müssen, der dann die Versicherer dieser Patienten unterstützt.
Insofern erscheint mir die geäußerte Sorge und Kritik völlig gerechtfertigt, die Schlussfolgerung dann aber zu einfach.
Die zu einfache Schlussfolgerung im eingangs erwähnten Leserbrief finde ich nicht, außer zwischen den Zeilen, bitte nicht die Privaten abschaffen. Das in der Antwort vorhandene Gedankenspiel läuft auf eine Abschaffung der Gesetzlichen per Privatisierung hinaus. In der Summe würde das bedeuten, Private gut, Gesetzliche schlecht. Die Forderung sollte aber lauten, beide haben, verdammt nochmal, gut zu sein. Das waren sie doch. Was ist passiert? Die Stiftung Warentest bedient die Frage, welche Kasse soll ich nehmen (altuell https://www.test.de/Private-Krankenversicherung-Alles-was-Sie-wissen-muessen-5353750-0/ ) und zeigt damit, die Gründe für jeden mal diese oder doch jene zu wählen ergeben, dass so wie es ist, beide Arten von Kasse ihre Berechtigung haben. Der generelle Schnitt ist das Einkommen. Unterhalb einer Grenze zahlt der Arbeitgeber zu, oberhalb braucht der Versicherte nicht die solidarische Hilfe der Gemeinschaft. Unterhalb daher der gesetzliche Zwang von 1883. Und da kommt der Gesetzgeber ins Spiel. Da ist ständig von zu starker finanzieller Belastung der Wirtschaft die Rede, von der Senkung der Lohnnebenkosten, etc. Schließlich soll der Arbeiter ebenfalls sein Einkommen nicht geschmälert bekommen. Im Ergebnis will der Gesetzgeber und sorgt auch dafür, dass die Gesetzlichen die Beiträge nicht erhöhen. Deshalb schaut der Gesetzgeber zu und erlaubt, dass diese ihre Ausgaben verringern. Alles wäre wie vor 50 Jahren, wäre der Durchschnittslohn heute 30 Euro und die Schere zwischen Arm und Reich auch wie damals. Was wegen internationaler Konkurrenz nicht geht und der Kapitalismus nicht erlaubt. Der Gesetzgeber redet daher schon 30 Jahre lang von GKV Reformen und meint, die Beiträge niedrig zu halten. Dann muss er, da die Insel der Seligen von vor 50 Jahren unerreichbar ist, in den sauren Apfel beißen und selber die Gesetzlichen angemessen bezuschussen.
Nein, es ist nicht ein Entweder Oder. Sinnvoll wäre bei Erhalt der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auch bei der Rechnungsstellung eine direkte Arzt-Patient-Beziehung zu schaffen wie bei der Privatversicherung. Die Patientin erhält vom Arzt eine Rechnung, prüft diese und leitet sie an die Kasse weiter, die die Rechnung begleicht. Das schafft Transparenz auch der Kosten für alle Beteiligten. Da in der GKV besonders viele Menschen versichert sind, die mit ihrem Geld nicht wirtschaften können, braucht es dann noch Sonderregelungen, z.B. dass bei Suchtabhängigen das Geld direkt von der Kasse zur Ärztin fließt.